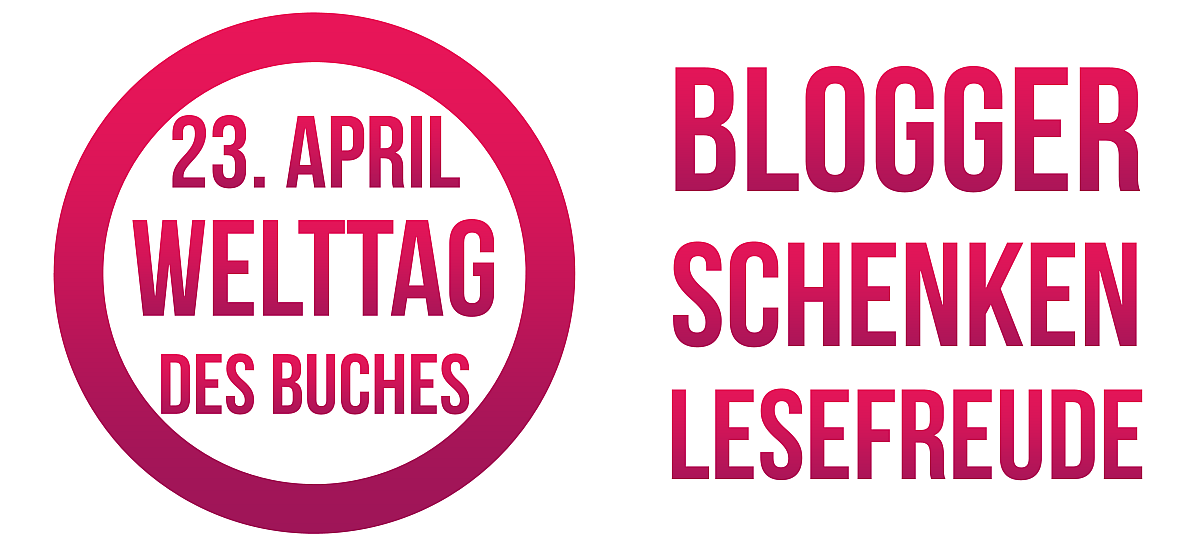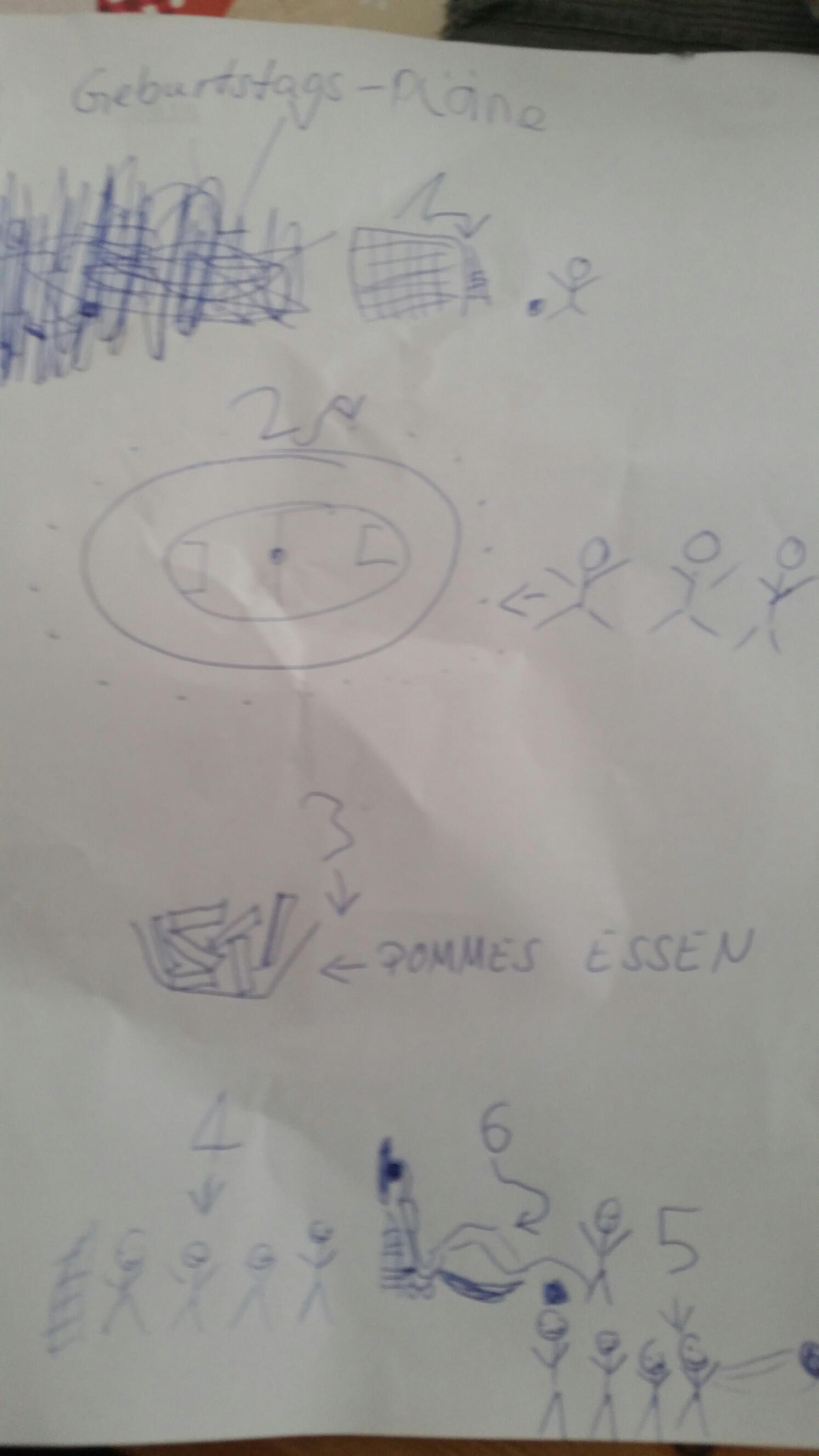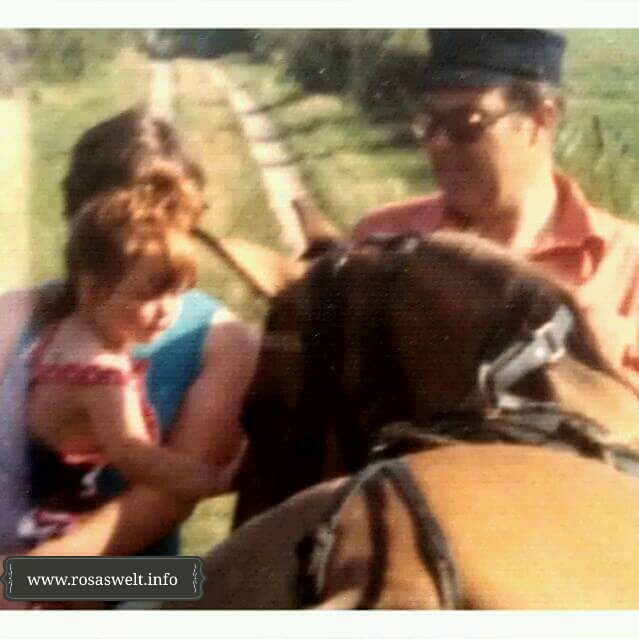Mein erstes Mal… ich kann mich nicht an den genauen Tag, nicht mal das Jahr erinnern. Ich weiß nur, dass ich noch gar nicht lesen konnte. Meine große Schwester musste auf mich aufpassen und nahm mich dorthin mit, wo sie gerne war. In unsere kleine Bücherei.
Das war Liebe auf den ersten Blick, dafür muss man keine Buchstaben kennen. So viele Geschichten, die einem vorgelesen werden können, so viele Bilder, mit denen man sich selbst Geschichten erzählen kann. Die Begeisterung lässt sich heute noch an meinem allerersten Zeugnis ablesen: „Das Rechnen mit Zahlen bis 20 fällt ihr manchmal schwer. Aber sie kann sehr gut frei Geschichten wiedergeben und sich eigene ausdenken.“ Bücher haben mich seit je her wesentlich geprägt.
Mit unserem Großen war ich in Beuel das erste Mal in der Stadtteilbücherei, da war er gerade 2 Jahre alt. Bei trübem Wetter auf Bilderbuchreisen gehen.
Seitdem sind wir dort regelmäßig, der Kleine war schon als Baby mit. In den Regalen stöbern, sich ins „Piratenschiff“ oder in die „Eule“ mit einem besonders schönen Exemplar zurückziehen, um in Ruhe darin zu blättern. Ob das Sams, Räuber Hotzenplotz, der Elefant Elmar oder das gesamte „Wilde Pack“, sie alle haben wir dort entdeckt und mit zu uns nach Hause genommen. Und bei so mancher Teufelskicker- oder Tigerentenbande-Cd bin ich als Mutter froh, dass wir sie leihen (und wieder zurückgeben) konnten.
Das alles machen unsere Kinder wahnsinnig gern, die Bücherei gehört für sie zu ihrem Stadtteil – wie der heiß geliebte Spielplatz, die Kita, die Schule.
Denn eine Stadtteilbücherei ist weit mehr als nur ein Ansammlung von Büchern. Die Kinder besuchen dort Lesungen, Bilderbuchnachmittage, kleine Aufführungen, Bastelnachmittage. Eben alles, was irgendwie ans Buch heranführt.
Die Stadtteilbücherei ist überschaubarer als ein großes Haus der Bildung, vor allem ist sie vertraut. Meine Jungs kennen sich dort aus. Geben auch schon mal alleine Bücher zurück. Sie kennen die Mitarbeiter/innen. Und als ich mit dem Großen darüber sprach, was er machen könnte, welche Orte er aufsuchen könne, wenn er allein unterwegs sei, sich unsicher fühle oder ihm etwas passiert sei, da sagte er gleich: Ich könnte auch in die Bücherei gehen.
All das kann eine zentrale, noch so gut ausgestattete Bibliothek in der Innenstadt nicht leisten. Denn die werden wir wahrscheinlich kaum besuchen. Schon mal gar nicht die Kinder allein. Und der regelmäßige Besuch der Schulen fiele wohl auch weg.
Es ist schon klar, dass in Städten gespart werden muss. Aber leider hat man immer wieder das Gefühl, das für Prestigeobjekte Geld ausgegeben wird, das an anderer Stelle besser aufgehoben gewesen wäre. Das auf Ehrenamt gesetzt wird, das Personal abgezogen, Büchereien vor Ort gar geschlossen werden, wo sie den potenziellen Leser eigentlich noch abholen könnten. Denn es ist wie mit dem Lesen – sie müssen herangeführt werden, es kennenlernen. Und wenn Kinder nicht an Büchereien herangeführt werden, gehen sie höchstwahrscheinlich auch als Erwachsene einfach nur dran vorbei. Denn das, was der Name verspricht, erledigen die Stadtteilbüchereien doch seit Jahren. Sie sind Häuser der Bildung. Direkt vor Ort.
Also, geht raus in die kleinen Büchereien bei euch um die Ecke.