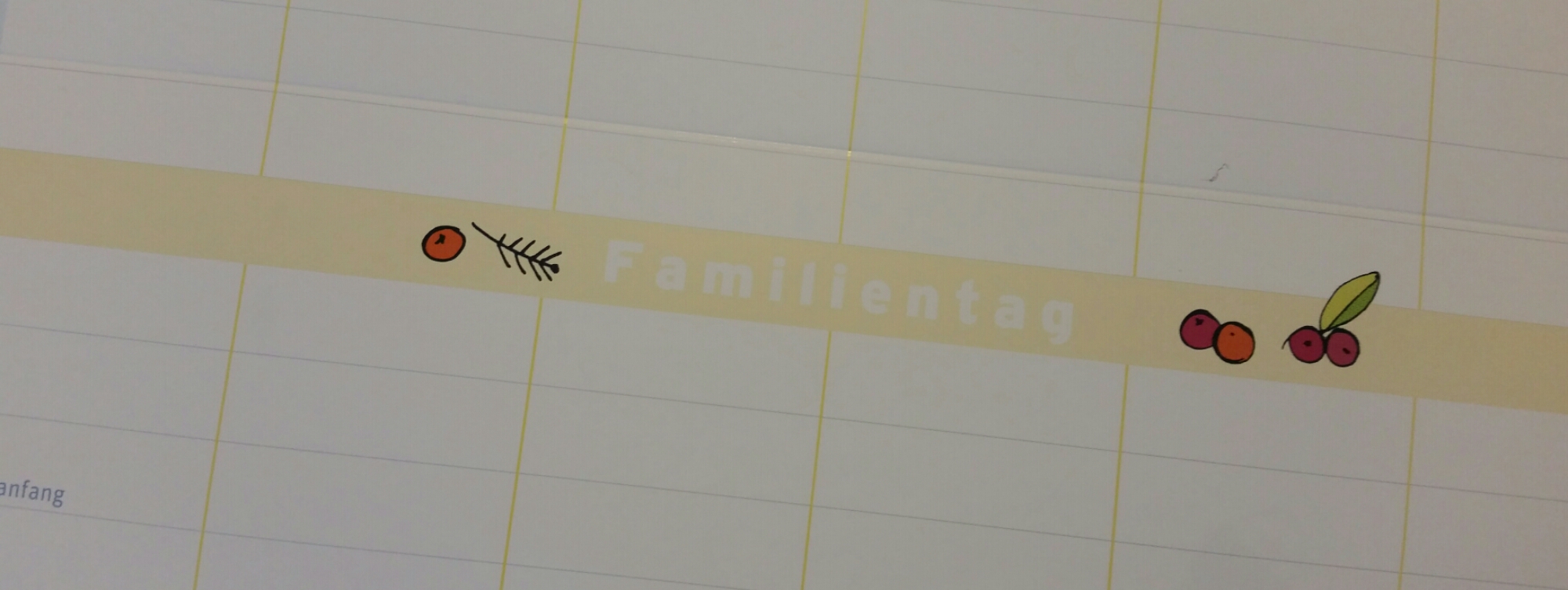Was genau passiert ist, weiß ich nicht. Ich habe nur den kleinen Zettel gefunden, eher ein Schnipsel. Auf der einen Seite ein Mini-Strichmännchen, ihm gegenüber zwei weitere. Die zwei haben ihre Arme ausgestreckt, zeigen auf den Einen. In der Mitte mit ganz kleinen Buchstaben, so dass es etwas länger gedauert hat, bis ich es entziffert hatte: „HaHa“.
Der Große hat sich mit seinen Freunden gestritten. Er hat auch ausgeteilt, gezankt, aber letztendlich standen zwei Meinungen gegen seine. Seine beiden besten Freunde, die ihn aufgezogen und geärgert haben. Es tat ihm so weh. Er hat die Tränen schnell weggewischt, doch ich konnte es sehen. Darüber sprechen wollte er nicht. Konnte er vielleicht auch in diesem Moment gar nicht. Wie soll man das auch beschreiben? Fühlt man gerade Wut, ist das Angst, Verletztheit, hat man gerade jemanden verloren, den man mag? Was ist das, was da manchmal im Bauch oder im Herz so weh tut, dass es einem die Kehle zusammenschnürt?
Im Kindergarten war das bisher noch leichter. „Du bist nicht mehr mein Freund“, hieß es dann. Und am nächsten Morgen war alles wieder vergessen. Jetzt langsam, in der Schule, wird es ernster. Verletzendes wird verstanden, auch gezielter ausgeteilt. Die Frage nach dem Warum kommt auf. Wieso machen Freunde da mit, wenden sich gegen mich?
Ich würde ihm so gern diese Sorgen abnehmen, alles klären. Aber ich weiß, dass er es selber machen muss. Lernen muss, mit Verletzungen umzugehen (und um es direkt klarzustellen: ich spreche jetzt hier von alltäglichen Zwistigkeiten, nicht Mobbing oder schwerwiegenden Eskalationen). Ich kann nur Rat gebend, Trost spendend zur Seite stehen, wenn er es möchte.
Für solche Fälle, kleinere und größere Sorgen, die einem im Alltag begegnen, haben wir ihm im vergangenen Jahr zur Einschulung ein „Sorgenfresserchen“ in die Schultüte gepackt. Das kleine gestreifte Plüsch-Etwas hängt seitdem an seinem Bett. Und wenn ihn die schimpfende Mama nervt, er zu Unrecht verdächtigt wurde, etwas gemacht zu haben, oder eben sich mit seinen Freunden gestritten hat und es nicht in Worte fassen kann, dann malt er, was ihn bedrückt. Dann bekommt der Sorgenfresser den Zettel ins Maul gestopft. Und am nächsten Morgen ist der Zettel weg. Dann geht es ihm viel besser und im Idealfall ist ihm eingefallen, wie er dem Problem auf den Grund gehen kann. Und er kann es dann ansprechen.
Manchmal wünsche ich mir auch so einen Sorgenentsorger. Wenn ich nachts wachliege, weil mir ein scheinbar unlösbares Ärgernis, eine schwierige Aufgabe den Schlaf raubt. Für plötzlich auftauchende Ideen habe ich meist einen Block auf meinem Nachttisch liegen. Aufschreiben, damit man sie nicht vergisst und trotzdem wieder einschlafen kann. Vielleicht sollte ich mir auch ein kleines, buntes Säckchen daneben hängen, in dass ich dann die blöden Gefühle, ängstigenden Gedanken und sonstige Grübeleien stecken kann. Vielleicht würde das vielen von uns die Nächte und eben auch den Alltag leichter machen.
Der Sohn hat es übrigens am nächsten Morgen mit den Freunden geklärt. Festgestellt, dass sie auch verletzt waren. Dann haben sie wieder zusammen Fußball gespielt. Als er nachmittags in seinen Sorgenfresser schaute, rief er mich zu sich: „Mama, der Zettel ist weg.“ „Dann hat ihn wohl der Sorgenfresser aufgefressen“, hab ich geantwortet. Mein Großer grinste, zwinkerte mir zu und sagte: „Ja, dann hat DER den wohl aufgefressen.“
P.S. Das ist kein gesponsorter Beitrag, sondern es geht schlicht und allein um die Art, seine Sorgen zu teilen oder bestenfalls sogar los zu werden. Es gibt verschiedenste Formen von „Sorgenentsorgern“, man kann sie kaufen, selber nähen oder die Sorgen einfach in einen schönen Sack stecken. Hauptsache, es hilft.