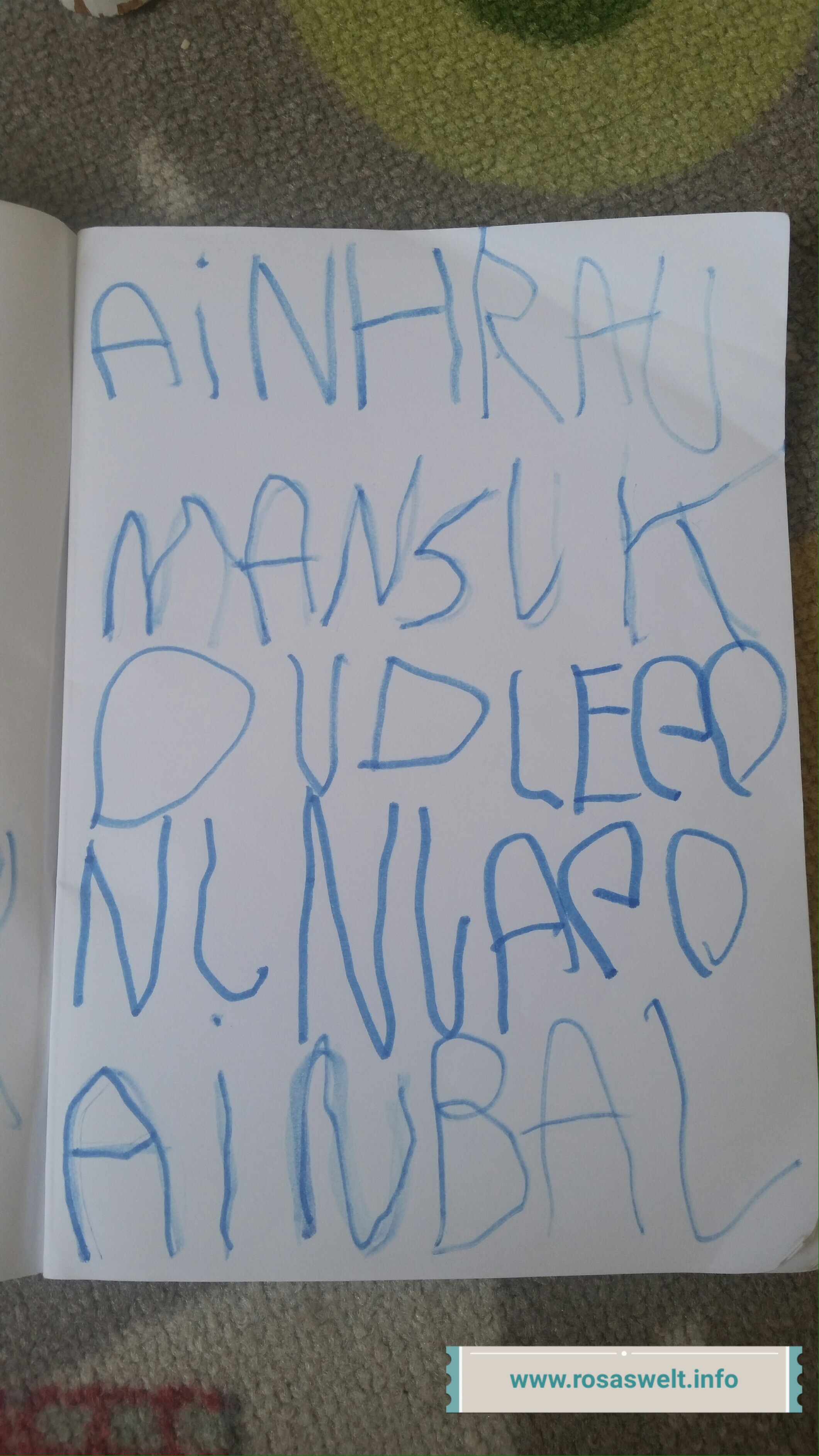15 Jahre ist es in diesem Monat her. Vor 15 Jahren nahm ich meinen ersten Flug in die USA, auf dem Weg zu meinem Praktikum. Ich hatte Bilder im Kopf von dieser Stadt, von diesem Land, von diesem Kontinent. Viele wurden in den Monaten darauf übermalt, korrigiert, von schwarz-weiß in bunt gefärbt – oder umgekehrt.
Ich habe New York in alle Himmelsrichtungen erkundet. Zu einer Zeit, als in der Stadt eine frische, riesige Wunde klaffte. Einer Zeit, in der die Menschen dort zutiefst verletzt worden waren. In der nur wenig Touristen dorthin kamen, wo noch der Staub von 09/11 lag. Und ich bin mit offenen Armen, Freude und Neugier empfangen worden. „Es ist schön, dass du dich traust, dass du hier bist“, hat mir mal ein wildfremder Mann auf der Straße gesagt, als ich zwischen Häuserschluchten nach einer Adresse frug.
Ich habe Amerika nicht als das Land der unbegrenzten Möglichkeiten, der absoluten Gleichberechtigung, des gelebten Multikulti erlebt. In der Stadt, die für mich als der Schmelztiegel galt, lernte ich schnell, dass es immer noch Hierarchien gab. Nach Hautfarbe, nach Herkunft, nach Nationalität. Ein friedliches Nebeneinander im besten Sinne. Ich erinnere mich an das Interview einer Kollegin mit einem Comedypaar, das sein Leben zum Programm gemacht hatte – ein Jude und eine Schwarze, die dafür kämpften, ein Paar sein zu können. Ich erinnere mich aber auch an ein Aufeinanderzugehen. Eine gemeinsame Feier einer Synagogengemeinde mit der domenikanischen Nachbarschaft, jahrzehnte hatten sie nur nebeneinander gelebt. Man wollte an vielen Orten, dass aus dem Neben- ein Miteinander wird.
Mein Lieblingsstadtteil wurde schnell Brooklyn in all seiner Vielfalt. Williamsburg mit den Künstlern, die in alten Fabriken lebten, Studenten, Familien. Von roten Backsteinhäuschen in gefegter Straße in Brooklyn Heights über alte Brauereien in Dumbo vollgesprüht mit Graffiti hin zu kleinen Cafés mit selbstgebackenem Kuchen (zu bezahlbaren Preisen). Und ersten hippen Restaurants sowie Protestschildern davor, die vor der Kommerzialisierung der Viertel warnten.
Einer dieser Spaziergänge führte mich nach Coney Island, eigentlich ganz an den Rand davon. Ich ging mit einer meiner Mitbewohnerinnen am Meer entlang, bis wir vor einer Mauer standen. Wir gingen die Mauer entlang, weil wir uns nicht erklären konnten, was diese Eingrenzung des Meeres zu bedeuten hatte. Und landeten vor einem bewachten Tor. Mein erstes, unbedarftes Zusammenprallen mit einer „Gated Community“.
Wir erzählten den Wachmännern, dass wir aus Deutschland kämen („aber dann kennt ihr das mit einer Mauer doch“). Ich erzählte von meinem Praktikum in der Redaktion und wollte mehr wissen, von dem Leben hinter der Mauer. Dem freiwilligen.
Es war ein ruhiger Nachmittag an einem Wochentag und sie beschlossen, dass sie uns wohl ohne Ärger hinein lassen konnten. Und so fuhren meine Mitbewohnerin und ich in einem Streifenwagen durch die Straßen dieser ganz eigenen Welt. Hinter dem Tor war alles weiß. Die ordentlichen Einfamilienhäuser, die sauberen Straßen und die Bewohner. Was gerade in diesem Teil von Brooklyn sofort auffiel. Auf einem Basketballplatz warfen zwei Jungs Körbe, in einem Vorgarten wurden Blumen gegossen. Wenn sich das Tor öffnete, dann, damit ein großer Familienwagen vorfahren konnte.
Die Wachmänner haben unser Staunen belächelt. Doch bis heute ist diese Parallelwelt innerhalb einer Stadt wie New York das Skurrilste, Irrealste, was ich dort gesehen habe. Dieses sich Abgrenzen von anderen, diese gelebte Angst, inmitten gerade dieser Stadt – ich konnte es einfach nicht verstehen. Es war mir so fremd.
Dann lese ich heute neueste Nachrichten aus den USA. Starre fassunglos auf jüngste Bestimmungen, Kündigungen. Auf Mauern, die man um das Land bauen will.
Für mich war Amerika nicht das Land, in dem alle friedlich, vorurteilsfrei und gleichberechtigt miteinander lebten. Ich traf dort auf Armut und sehr konservative Regelungen. Aber ich habe es auch kennengelernt als das Land des friedlichen Nebeneinanders, das manchmal sogar zu einem Miteinander werden konnte. Ich habe so viele Menschen dort kennengelernt, die Grenzen überwinden wollten, die aufeinander zugingen, die im wahrsten Sinne weltoffen waren.
Das ist 15 Jahre her. Ich weiß, es gibt viele dort, die mit dem, was derzeit in ihrem Land geschieht, nicht einverstanden sind, auf die Straße gehen, ihre Stimme erheben.
Dennoch: Ich hätte es mir 2002 nicht vorstellen können. Aber Amerika 2017 macht mir Angst.